Klaus1602
Mitglied
- Beiträge
- 346
Hallo zusammen
Ich bin heute mit einer "Kältebehandlung" konfrontiert worden, von der ich bisher noch nichts gehört hatte.
Dem sogenannten Freeze Cycle Prozessing.
Mit dieser Behandlung werden sagenhafte Werkstoffverbesserungen in Bezug auf Standzeiterhöhung etc. angepriesen.
Fertig behandelte Werkzeuge (also bereits gehärtet und angelassen) werden mehrfach einer Tieftemperaturbehandlung in flüssigem Stickstoff über lange Zeit ausgesetzt und dann wieder geregelt aufgewärmt. So ein Prozess soll ca. 48h dauern.
Es hat nichts mit der TK-Behandlung nach dem Abschrecken zu tuen.
Es kursieren dort Werte von Standzeiterhöhungen von 817% beim 1.2379 (um nur ein Beispiel zu nennen)
Ein paar Infos findet Ihr hier:
http://www.mesote.com/tabelle1.htm
http://www.precitec-gmbh.de/werkzeugoptimierung.htm
Ich frage mich jetzt ob man das ernst nehmen kann oder ob dies Marketinggelabere ist ?
Ich zitiere mal einen Satz:

Hat jemand von Euch damit schon Erfahrungen sammeln können?
Kann mir einer die Vorgänge, die dort abgehen erklären?
Gruß Klaus
P.S.
Gerne würde ich dazu auch was von Herbert, Roman und U.Gerfin hören.
Ich bin heute mit einer "Kältebehandlung" konfrontiert worden, von der ich bisher noch nichts gehört hatte.
Dem sogenannten Freeze Cycle Prozessing.
Mit dieser Behandlung werden sagenhafte Werkstoffverbesserungen in Bezug auf Standzeiterhöhung etc. angepriesen.
Fertig behandelte Werkzeuge (also bereits gehärtet und angelassen) werden mehrfach einer Tieftemperaturbehandlung in flüssigem Stickstoff über lange Zeit ausgesetzt und dann wieder geregelt aufgewärmt. So ein Prozess soll ca. 48h dauern.
Es hat nichts mit der TK-Behandlung nach dem Abschrecken zu tuen.
Es kursieren dort Werte von Standzeiterhöhungen von 817% beim 1.2379 (um nur ein Beispiel zu nennen)
Ein paar Infos findet Ihr hier:
http://www.mesote.com/tabelle1.htm
http://www.precitec-gmbh.de/werkzeugoptimierung.htm
Ich frage mich jetzt ob man das ernst nehmen kann oder ob dies Marketinggelabere ist ?
Ich zitiere mal einen Satz:
Das sind eigentlich Diffusionsvorgänge ! Aber bei -180°C ??Durch diese Behandlung im Tiefst-Temperaturbereich wird dem Material genug Zeit gegeben, um Gitterfehler in den Mikrokristallen „auszuheilen“, eine geordnetere Kristallstruktur aufzubauen und dabei eine Umwandlung der Mikrostruktur in ein gleichförmigeres, feinkörnigeres Gefüge zu erreichen.

Hat jemand von Euch damit schon Erfahrungen sammeln können?
Kann mir einer die Vorgänge, die dort abgehen erklären?
Gruß Klaus
P.S.
Gerne würde ich dazu auch was von Herbert, Roman und U.Gerfin hören.
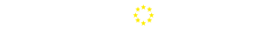



 (den Satz könnt ihr euch selber vervollständigen)
(den Satz könnt ihr euch selber vervollständigen)